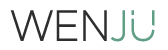Wenn Kontrolle zurückschlägt: Warum Unsicherheit alte Management- & Führungsmuster reaktiviert
Komplexität und Unsicherheit prägen unsere Arbeitswelt wie nie zuvor. Transformationen, geopolitische Spannungen, disruptive Technologien und die Beschleunigung durch KI führen dazu, dass Organisationen und Führungskräfte sich ständig neu orientieren müssen. Doch gerade in solchen Momenten passiert etwas Paradoxes: Statt mutig nach vorne zu führen, greifen viele in alte Schubladen – und holen Kontrollmechanismen hervor, die eigentlich längst überwunden schienen.

Der Reflex zur Kontrolle
Psychologisch ist dieses Verhalten nachvollziehbar: Studien zeigen, dass Menschen in unsicheren Situationen ihre Selbstwirksamkeit steigern wollen (vgl. Deci & Ryan, 2000). Wenn jedoch Orientierung fehlt, geschieht dies oft über Kontrolle – durch Mikromanagement, starre Berichtspflichten oder das Rückdrehen von Entscheidungsspielräumen.
Ein aktuelles Beispiel: In vielen Unternehmen wurden nach der Pandemie neue Freiheiten im hybriden Arbeiten gewährt. Doch sobald wirtschaftliche Unsicherheiten stiegen, führten einige Firmen wieder Präsenzpflichten ein – nicht primär aus Produktivitätsgründen, sondern aus dem Bedürfnis, das diffuse Gefühl von Kontrollverlust zu kompensieren.
Ähnlich zeigt sich der Reflex in Change-Prozessen: Statt Teams in den Dialog einzubeziehen, setzen manche Führungskräfte auf Top-down-Ansagen. Das steigert kurzfristig die Steuerbarkeit, wirkt langfristig aber wie ein Bumerang: Motivation sinkt, Vertrauen erodiert, Talente wandern ab.
Die Nebenwirkungen von Kontrollmustern
Kontrolle mag Sicherheit suggerieren, doch sie erzeugt neue Risiken:
Kreativität und Innovationsfähigkeit werden gehemmt, weil Mitarbeitende auf „Absicherung“ statt auf mutige Ideen setzen.
Psychologische Sicherheit sinkt: Wer spürt, dass jede Handlung überwacht wird, hält sich zurück (Edmondson, 2019).
Komplexität bleibt ungelöst: Kontrolle reduziert nur Symptome, während die eigentlichen Ursachen von Unsicherheit – fehlende Klarheit, mangelnde Priorisierung, widersprüchliche Signale bestehen bleiben.
Kurz: Kontrolle ist eine scheinbare Lösung, die in Wirklichkeit das Problem verlängert.
Was Führung jetzt braucht
Statt in alte Muster zurückzufallen, können Führungskräfte Unsicherheit besser auffangen, wenn sie andere Hebel nutzen:
1. Orientierung statt Kontrolle
Komplexität lässt sich nicht durch Detailsteuerung auflösen – wohl aber durch klare Richtungsentscheidungen. Ein gemeinsames „Warum“ und transparente Prioritäten geben Halt, ohne die Autonomie zu beschneiden.
2. Vertrauen in Selbstorganisation
Teams sind oft näher an Kund:innen und Märkten als das Top-Management. Führung sollte Rahmen und Leitplanken setzen, aber die konkrete Umsetzung den Mitarbeitenden überlassen. Forschung belegt: Selbstorganisierte Teams sind resilienter und reagieren schneller auf Veränderungen (Laloux, 2016).
3. Psychologische Sicherheit kultivieren
Gerade in unsicheren Zeiten brauchen Menschen Räume, in denen sie offen über Zweifel und Fehler sprechen können. Nur so werden Risiken früh sichtbar und Lernprozesse möglich. Führungskräfte sollten aktiv nachfragen: „Was übersehen wir gerade?“, „Was macht dir Sorgen?“
4. Dialogformate schaffen
Regelmäßige Check-ins, bereichsübergreifende Lernrunden oder Retrospektiven helfen, Unsicherheit gemeinsam zu verarbeiten. Entscheidend ist, dass diese Formate nicht als Kontrolle wahrgenommen werden, sondern als Plattform für Austausch.
“Fazit”
Mut zum Loslassen
Der Reflex zur Kontrolle ist menschlich – aber nicht zukunftsfähig. Komplexität lässt sich nicht durch Mikromanagement zähmen, sondern nur durch Vertrauen, Orientierung und die Stärkung gemeinsamer Lernfähigkeit.
Führungskräfte, die diesen Mut aufbringen, erleben oft einen überraschenden Effekt: Aus Unsicherheit wird nicht lähmender Druck, sondern kollektive Energie. Oder, wie es die Harvard-Professorin Amy Edmondson formuliert: „The best teams aren’t afraid to fail – they are afraid of not learning.“
Autor: Kevin Traykov
Literatur:
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.
Edmondson, A. (2019). The Fearless Organization. Wiley.
Laloux, F. (2016). Reinventing Organizations.